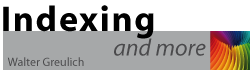Querverweise
Indexing in den Naturwissenschaften XII: Untersuchung einiger Register
Kennzeichen von Autorenregistern
Bei der Untersuchung der Register einiger naturwissenschaftlicher Werke unterschiedlicher Verlage kam ein Ergebnis heraus, dass sich voll und ganz mit meinem Erfahrungswert deckt: Bei den von den Autoren/Herausgebern selbst erstellten Registern
- wurden die Untereinträge ausschließlich nach dem Hierarchie-Prinzip gebildet („atomisierende“ Vorgehensweise),
- wurde kaum (in den meisten Fällen gar nicht) mit Double Postings gearbeitet,
- wurden Verweise nur sehr spärlich eingesetzt,
- wurden sehr oft Seitenzahlbandwürmer gebildet.
Bild 1: Analyse von Lehrbuchregistern
Aus meiner Erfahrung sind besonders zwei Punkte den meisten Autoren/Herausgebern als Indexern völlig fremd:
- das Bilden von Untereinträgen unter Berücksichtigung von übergeordneten Konzepten (integrierende Vorgehensweise, Kontextprinzip)
- der Einsatz von Double Postings.
Diese beiden Punkten fehlen in Autorenregistern praktisch immer (siehe Tabelle) und an diesen Punkten kommt es fast immer zu Diskussionen, wenn Autoren das von einem Profi-Indexer erstellte Register zur Prüfung vorgelegt bekommen. Der Indexer sollte aber versuchen, dem Autor gegenüber hart zu bleiben und ihm zu vermitteln, dass die Aufnahme von Kontexten und der Einsatz von Double Postings dem Leser sehr hilft. Natürlich wird der Versuch nur gelingen, wenn das Register in sich konsistent ist.
Die Aufnahme von Merkmalhinweisen, also z. B. „t“ für „Table“, „s“ für „summaray“, „d“ für „definition“ oder „b“ für „basic“ findet sich in nur wenigen Registern. Es fällt auf, dass die beiden von Profi-Indexern erstellten Register solche Merkmale mitführen. Allerdings sind Merkmalhinweise nicht immer für den Leser hilfreich, manchmal überfrachten sie ein Register. Ob ihre Aufnahme sinnvoll ist oder nicht, hängt von den Besonderheiten des jeweiligen Buches ab (z. B. ob viele Infografiken enthalten sind oder Definitionen eine große Rolle spielen usw.), außerdem muss bedacht werden, dass diese didaktischen Zusatzinformationen Platz kosten (der evtl. nicht vorhanden ist).
Unterschiede zwischen den Gebieten Physik, Chemie,
Eintrag
- Thema (= Hauptthema, HT),
- Unterthema (UT) und
- Locator-Verweis (L-Verweis) oder Querverweis (Q-Verweis).
Beispiel: Im Indexeintrag
| nanomaterials, anisotropic bimetallic 197-240 |
ist nanomaterials das Thema (oder
Indexing in den Naturwissenschaften I: Stichworte, Schlagworte, Synonyme
Heute möchte ich einige Grundbegriffe –Stichworte, Schlagworte und Synonyme – klären.
Stichworte, Schlagworte, Synonyme
In den Naturwissenschaften kommt es immer – ganz besonders bei Monographien oder Nachschlagewerken – darauf an, möglichst dicht am geschriebenen Inhalt zu bleiben. Der Leser erwartet, in den meisten Fällen einen Registerbegriff so geschrieben im Buch zu finden. Mit anderen Worten: Ein naturwissenschaftliches Register ist zu einem guten Teil ein Stichwortregister. Aber das sollte es natürlich nicht ausschließlich sein. Ein gut durchdachtes, systematisch erstelltes Stichwortregister hat sicher seinen Wert, doch ausschließlich mit Stichworten kann ein Inhalt für den Leser nicht erschlossen werden.
Wie alle Fachbereiche hat auch jede Naturwissenschaft ihre eigene Sprache, die sich ständig weiterentwickelt. Von dieser Dynamik abgesehen, gibt es oft – trotz aller strengen Gesetzmäßigkeiten – für ein und dasselbe Konzept oder Verfahren, also für ein und denselben Begriff, mehrere zulässige Bezeichnungen, sodass selbst ein Experte seines Gebiets manchmal Verständnisschwierigkeiten hat, wenn er im Index nicht die Bezeichnung findet, die er gewohnt ist zu verwenden. Noch problematischer kann es werden, wenn Leser aus Nachbargebieten (der Biologe, der zum Physikbuch greift, oder der Physiker, der sich über Chemie weiterbilden möchte), in denen u.U. dieselben Bezeichnungen für ganz andere Begriffe verwendet werden, in das Register schaut.
Ein Beispiel ist der Begriff „Dispersion“. In der Physik versteht man darunter die Abhängigkeit einer bei der Wellenausbreitung relevanten Größe von der Wellenlänge (Wellenpakete z.B. können im Laufe der Zeit „auseinanderlaufen“, weil sich die einzelnen Wellen je nach Wellenlänge unterschiedlich schnell ausbreiten). In der Chemie dagegen handelt es sich bei einer Dispersion um ein aus mindestens zwei Phasen bestehendes Stoffgemisch. In einem Buch mit physikalisch-chemischen Inhalt könnte jede dieser Bedeutungen gemeint sein, und im zugehörigen Register müsste – am besten mit einem erklärenden Untereintrag – für Klarheit gesorgt werden.
Ein Register zu einem naturwissenschaftlichen Buch sollte immer auf die sprachlichen Gepflogenheiten im jeweiligen Bereich Rücksicht nehmen, es sollte sich so weit wie möglich an dem immer vorhandenen kontrollierten Vokabular zum Gebiet orientieren. Das bedeutet vor allem, dass Synonyme aufgenommen werden (speziell auch, dass ältere, nicht mehr gebräuchliche oder erlaubte Begriffe in das Register wandern, nach denen der Leser schauen könnte), und zwar am besten dadurch, dass von diesen Einträgen auf die gebräuchlichen (dem kontrollierten Vokabular entsprechenden) Einträge verweisen wird. Damit wird jedes naturwissenschaftliche Register immer auch Elemente eines Schlagwortregisters enthalten.
Bei den Synonymen erhebt sich die Frage, wie sie aufgenommen werden sollen. Als reine Querverweise? Im Prinzip ja, aber nur wenn es um zusätzliche Schlagwörter geht. Es kann auch den Fall geben (speziell bei Mehrautoren-Monographien), dass mehrere Synonyme im Text als eigenständige Begriffe mit längeren Textpassagen auftreten. Dann hat jeder Eintrag seine eigenen Seitenverweise und zusätzlich sollte untereinander, also von einem Synonym zum anderen, verwiesen werden.